Bittplätze an ägyptischen Tempeln vom 7. Jahrhundert v. Chr. bis zum 4. Jahrhundert n. Chr.
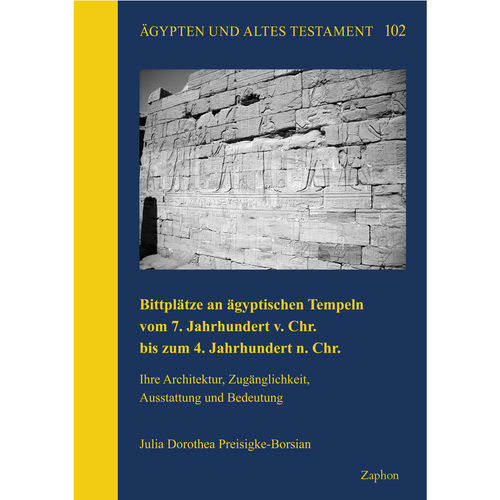
Bittplätze an ägyptischen Tempeln vom 7. Jahrhundert v. Chr. bis zum 4. Jahrhundert n. Chr.
Ihre Architektur, Zugänglichkeit, Ausstattung und Bedeutung
Julia Dorothea Preisigke-Borsian
Ägypten und Altes Testament 102
2021
XII + 520 Seiten / DIN-A4 / Hardcover, Fadenheftung
ISBN 978-3-96327-076-5 (Buch)
ISBN 978-3-96327-077-2 (E-Book, via ProQuest)
Buch + E-Book : 160,00 €, auf Anfrage
| Inhalt |
„Bittplätze“ sind architektonische Strukturen an peripheren Arealen ägyptischer Tempel: An Umfassungsmauern und Toren, in den Höfen und den Tempelvorplätzen, aber auch in den Arealen hinter den Tempeln, die von Borchardt 1933 als „Gegentempel“ bezeichnet wurden. Diese sind meist durch offizielle Stellen geplant und angelegt worden. Am Grundriss der Tempelareale sowie an den baulichen Gegebenheiten lässt sich ablesen, dass wahrscheinlich nur ausgewählte Menschen wie Priester, genauer Propheten, Zugang zu diesen sekundären Bittplätzen hinter den Tempeln hatten. Türen und Korridore ermöglichten den Zugang zu bestimmten, restriktiven Orten, konnten diese aber auch verschließen. Primäre Bittplätze direkt an Toren, an Umfassungsmauern der Tempelbezirke und an Dromoi waren besser zugänglich und wurden daher vermutlich häufiger von Laien aufgesucht. Die Bittplätze können im Niltal bereits seit der 18. Dynastie unter Thutmosis I. nachgewiesen werden, während sie in den westlichen Oasen erst seit der 25. / 26. Dynastie belegt sind. Sie werden insgesamt bis in die griechisch-römische Zeit gebaut und genutzt. Bei einem diachronen Vergleich der Bittplatzformen lässt sich keine eindeutige Entwicklung feststellen. Jedoch ist auffällig, dass die sekundären Bittplätze hinter den Tempeln sowohl im Niltal als auch in den Oasen während der griechisch-römischen Zeit zu einem typischen Element der Tempelanlagen wurden. Sie scheinen Ausdruck veränderter bzw. weiterentwickelter kultischer Handlungen zu sein. Dies lässt vermuten, dass Praktiken, die an diesen Kultstellen im Zuge des Tempelkultes stattgefunden haben, möglicherweise an Bedeutung gewannen. Nach dem bisherigen Kenntnisstand waren sekundäre Bittplätze nur an Göttertempeln vorhanden. Dies erscheint logisch, da die Bitten um Beantwortung von Orakelfragen oder rechtlicher Fragen sowie Bitten um Schutz v.a. an die Götter gerichtet wurden, seltener an gottgleiche oder vergöttlichte Menschen, die als Mittler zur göttlichen Sphäre fungierten. Als Grundlage für die Analyse in den Hauptteilen der Studie (Kap. 4 und 5) diente der ausführliche Katalog. Dort werden Informationen zur Architektur der Tempel und Bittplätze sowie der Funde gegeben. Zudem sind Datierung, Forschungsgeschichte und Grabungsstand der einzelnen, betrachteten Tempel und ihrer Bittplätze zu finden. In den 43 Katalogeinträgen werden insgesamt 59 Tempel detailliert besprochen und nach ihrem Standort in bestimmten Regionen geordnet. Von den 31 aufgenommenen Oasentempeln konnten 24 Heiligtümer vor Ort betrachtet, fotografisch dokumentiert und die Beobachtungen in die Untersuchung integriert werden. |
|---|---|
| Inhaltsverzeichnis |
Inhalt / Abkürzungsverzeichnis / Abkürzungen im Katalogteil 1 Einführung 2 Methodisches Vorgehen 2.1 Ziele und Fragestellungen der Untersuchung 2.2 Materialgrundlage und Methodik 2.3 Forschungsstand zum Thema der Bittplätze 2.3.1 Forschungsliteratur 2.3.2 Die Terminologie der Bittplätze 3 Theoretische Grundlagen für die Untersuchung 3.1 Ritualtheorien und Ritualdynamik 3.2 Theorien zum Kulturkontakt 4 Bittplätze an Tempeln der westlichen Oasen Ägyptens 4.1 Betrachtung der Bittplätze, ihrer Verortung am Tempel und ihrer Architekturformen 4.1.1 Bittplätze an Umfassungsmauern und Toren 4.1.2 Bittplätze an den Zugängen zum Temenos 4.1.3 Opferstätten und Bittplätze in Tempelhöfen 4.1.4 Formen der sekundären Bittplätze an den Rückwänden von Tempeln 4.1.5 Zusammenfassung zur Verortung, Architektur und Zugänglichkeit der Bittplätze 4.2 Ausstattung der Bittplätze, Darstellungen und Texte 4.2.1 Reliefdarstellungen und Beischriften an sekundären Bittplätzen 4.2.2 Abstrakte, bildliche und textliche Graffiti und ihre Verteilung am Tempel 4.2.3 Zusammenfassung zu den Darstellungen, Beischriften und Graffiti 4.3 An den Bittplätzen der Oasen verehrte Götter 4.3.1 Amun und die thebanische Triade 4.3.2 Isis und Osiris (Sarapis) 4.3.3 Tutu, Tapsais und Neith 4.3.4 Sobek und seine Erscheinungsformen 4.3.5 Thot und Nehmet-auai 4.3.6 Weitere Gottheiten 4.3.7 Zusammenfassung zu den verehrten Gottheiten 5 Bittplätze im Niltal und im Mittelmeerraum 5.1 Bittplätze an Tempeln im Niltal 5.1.1 Bittplatzformen im Niltal 5.1.2 Beinamen der Götter an den Bittplätzen des Niltals 5.1.3. Exkurs zum Gott Ptah 5.1.4 Vergleich der Bittplätze im Niltal und in den Oasen 5.2 Bittplätze an gräco-ägyptischen Heiligtümern im Mittelmeerraum 5.2.1 Heiligtümer mit Bittplätzen in Griechenland und Italien 5.2.2 Heiligtümer mit sekundären Bittplätzen in Kleinasien 5.2.3 Heiligtümer mit Bittplätzen an der afrikanischen Mittelmeerküste 5.3 Vergleich zwischen Bittplätzen des mediterranen und des ägyptischen Raumes 6 Diskussion und Interpretation zu den Bittplätzen in Ägypten 6.1 Überlegungen zu rituellen Praktiken an Bittplätzen und zur Interaktion zwischen Mensch und Gott 6.1.1 Was? 6.1.2 Wie? 6.1.3 Wo? 6.1.3 Wann? 6.1.4 Warum? 6.1.5 Zusammenfassung zu den rituellen Handlungen an Bittplätzen 6.2 Gegenseitiger Einfluss der griechisch-römischen und der ägyptischen Kultur im Rahmen der individuellen Religionsausübung 6.2.1 Kontakte und Transfer von Ideen innerhalb Ägyptens 6.2.2 Kontakte zu den Kulturen des Mittelmeerraumes 7 Zusammenfassung der Untersuchung zu den Bittplätzen an ägyptischen Tempeln 8 Katalog Fayum Kat. 1: Bacchias Kat. 2: Karanis /Kom Auschim – Zwei Tempel des Soknopaios und Pnepheros / Petesucho Kat. 3: Narmouthis / Medinet Madi – Tempel der Renenutet Kat. 4: Qasr Qarun / Dionysias – Tempel des Sobek Kat. 5: Soknopaiou Nesos – Tempel des Soknopaios Kat. 6: Tebtynis / Kom Umm el-Boreigat – Heiligtum eines Krokodilsgott Siwa Kat. 7: Aghurmi – Tempel des Amun (Zeus) Kat. 8: Bilad el-Rumi Kat. 9: Zeitun Baharija Kat. 10: Ain el-Tibniya – Alexander-Tempel des Amun Kat. 11: Qasr el-Bawiti – Tempel des Amun-Re von der Oase, Amun-Chons (Herakles/ Herkules-Tempel) & Tempel des Bes Dachla Kat. 12: Ain Amur – Tempel des Amun-Nacht Kat. 13: Ain Birbiya – Tempel des Amun-Nacht Kat. 14: Amheida – Tempel des Thot Kat. 15: Deir el-Hagar – Tempel der Thebanischen Triade bzw. Amun-Re Kat. 16: Kellis (Ismant el-Charab) – zwei Tempel: für Tutu und Neith sowie für Tapsais Charga Kat. 17: Ain Dabaschiya – Tempel des Anubis (?) Kat. 18: Hibis – Tempel des Amun und Mut Kat. 19: Ain el-Labacha Kat. 20: Manawir – Tempel des Osiris -jw Kat. 21: Nadura – 2 Tempel der Gottheiten der Thebanischen Triade (Mut, Amun, Chons) Kat. 22: Qasr el-Dusch – 2 Tempel der Isis und des Osiris Kat. 23: Qasr el-Ghueita – Tempel des Amun und der thebanischen Triade Kat. 24: Qasr el-Zayan – Tempel des Amun(-Re) von Hibis und der thebanischen Triade Niltal Unterägypten Kat. 25: Heliopolis – Tempel des Reharachte-Atum Kat. 26: Memphis – Tempel des Ptah Oberägypten Kat. 27: Deir el-Medine – Tempel der Hathor Kat. 28: Deir el-Schelwit – Tempel der Isis Kat. 29: Dendera – Tempel der Hathor und Tempel der Isis Kat. 30: Edfu – Tempel des Horus Kat. 31: Karnak Kat. 32: Kom Ombo – Doppeltempel des Sobek und Haroeris Kat. 33: Luxor – Tempel des Amun Kat. 34: Medinet Habu – Tempel von Ramses III. Kat. 35: Schenhur – Tempel der Isis Nubien Kat. 36: Dakke – Tempel des Thot Kat. 37: Kalabscha – Tempel des Mandulis Griechenland – gräco-ägyptische Heiligtümer Kat. 38: Delos – Sarapeion A - Inseln Griechenland) – Tempel für Sarapis, Isis, Anubis Delos – Sarapeion C – Tempel für Sarapis, Isis, Anubis, Harpokrates, Hydreios Kat. 39: Eretria – Festland (Griechenland) – Tempel für Isis, Sarapis und Anubis Kat. 40: Thessaloniki Kleinasien – gräco-ägyptische Heiligtümer Kat. 41: Pergamon – Rote Halle Italischer Raum – gräco-ägyptische Heiligtümer Kat. 42: Pompeji – Isis-Tempel Afrika – gräco-ägyptische Heiligtümer Kat. 43: Sabratha – 2 Tempel für Isis, Sarapis und Harpokrates 9 Bibliographie |
