Bittplätze an ägyptischen Tempeln vom 7. Jahrhundert v. Chr. bis zum 4. Jahrhundert n. Chr.
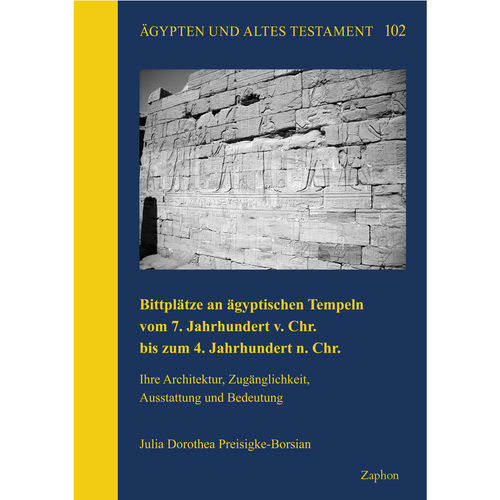
Bittplätze an ägyptischen Tempeln vom 7. Jahrhundert v. Chr. bis zum 4. Jahrhundert n. Chr.
Ihre Architektur, Zugänglichkeit, Ausstattung und Bedeutung
Julia Dorothea Preisigke-Borsian
Ägypten und Altes Testament 102
2021
ISBN 978-3-96327-076-5 (book)
ISBN 978-3-96327-077-2 (e-Book, via ProQuest)
XII + 520 pp. / DIN-A4 / hardcover, thread stiching
book + e-book : 160,00 €, on request
| Summary |
“Places of supplication” (“Bittplätze”) are architectural structures in peripheral areas of Egyptian temples: on enclosing walls and gates, in the courtyards and the temple forecourts, but also in the areas behind the temples, which Borchardt described in 1933 as “counter temples” (“Gegentempel”). These have mostly been planned and created by official bodies. From the layout of the temple areas and the structural conditions, it can be seen that probably only selected people such as priests, more precisely prophets, have access to these secondary places of supplication behind the temples. Doors and corridors allowed access to certain, restrictive places, but could also lock them. Primary prayer places directly at the gates, on the surrounding walls of the temple precincts and on the Dromoi were more accessible and were therefore probably visited more often by lay people. In the Nile Valley, the places of prayer have been recorded since the 18th dynasty under Thutmose I, while in the western oases they have only been occupied since the 25th / 26th dynasty. Overall, they were built and used until the Greco-Roman times. A diachronic comparison of the forms of supplication does not reveal any clear development. However, it is noticeable that the secondary petitions behind the temples both in the Nile Valley and in the oases became a typical element of the temple complexes during the Greco-Roman period. They seem to be an expression of changed or further developed cultic actions. This suggests that practices that have taken place at these cult sites in the course of the temple cult may have gained in importance. According to the current state of knowledge, secondary petitions were only available at temples of the gods. This seems logical, given the requests for an answer from Oracle questions or legal questions as well as requests for protection were directed mainly to the gods, less often to godlike or deified people who acted as mediators to the divine sphere. The detailed catalog served as the basis for the analysis in the main parts of the study (Chapters 4 and 5), providing information on the architecture of the temples and places of worship as well as the finds. In addition, the dating, research history and excavation status of the individual temples and their places of worship can be found. In the 43 catalog entries a total of 59 temples are discussed in detail and sorted according to their location in certain regions. Of the 31 oasis temples recorded, 24 sanctuaries could be viewed on site, documented photographically and the observations integrated into the investigation. |
|---|---|
| Table of Contents |
Inhalt / Abkürzungsverzeichnis / Abkürzungen im Katalogteil 1 Einführung 2 Methodisches Vorgehen 2.1 Ziele und Fragestellungen der Untersuchung 2.2 Materialgrundlage und Methodik 2.3 Forschungsstand zum Thema der Bittplätze 2.3.1 Forschungsliteratur 2.3.2 Die Terminologie der Bittplätze 3 Theoretische Grundlagen für die Untersuchung 3.1 Ritualtheorien und Ritualdynamik 3.2 Theorien zum Kulturkontakt 4 Bittplätze an Tempeln der westlichen Oasen Ägyptens 4.1 Betrachtung der Bittplätze, ihrer Verortung am Tempel und ihrer Architekturformen 4.1.1 Bittplätze an Umfassungsmauern und Toren 4.1.2 Bittplätze an den Zugängen zum Temenos 4.1.3 Opferstätten und Bittplätze in Tempelhöfen 4.1.4 Formen der sekundären Bittplätze an den Rückwänden von Tempeln 4.1.5 Zusammenfassung zur Verortung, Architektur und Zugänglichkeit der Bittplätze 4.2 Ausstattung der Bittplätze, Darstellungen und Texte 4.2.1 Reliefdarstellungen und Beischriften an sekundären Bittplätzen 4.2.2 Abstrakte, bildliche und textliche Graffiti und ihre Verteilung am Tempel 4.2.3 Zusammenfassung zu den Darstellungen, Beischriften und Graffiti 4.3 An den Bittplätzen der Oasen verehrte Götter 4.3.1 Amun und die thebanische Triade 4.3.2 Isis und Osiris (Sarapis) 4.3.3 Tutu, Tapsais und Neith 4.3.4 Sobek und seine Erscheinungsformen 4.3.5 Thot und Nehmet-auai 4.3.6 Weitere Gottheiten 4.3.7 Zusammenfassung zu den verehrten Gottheiten 5 Bittplätze im Niltal und im Mittelmeerraum 5.1 Bittplätze an Tempeln im Niltal 5.1.1 Bittplatzformen im Niltal 5.1.2 Beinamen der Götter an den Bittplätzen des Niltals 5.1.3. Exkurs zum Gott Ptah 5.1.4 Vergleich der Bittplätze im Niltal und in den Oasen 5.2 Bittplätze an gräco-ägyptischen Heiligtümern im Mittelmeerraum 5.2.1 Heiligtümer mit Bittplätzen in Griechenland und Italien 5.2.2 Heiligtümer mit sekundären Bittplätzen in Kleinasien 5.2.3 Heiligtümer mit Bittplätzen an der afrikanischen Mittelmeerküste 5.3 Vergleich zwischen Bittplätzen des mediterranen und des ägyptischen Raumes 6 Diskussion und Interpretation zu den Bittplätzen in Ägypten 6.1 Überlegungen zu rituellen Praktiken an Bittplätzen und zur Interaktion zwischen Mensch und Gott 6.1.1 Was? 6.1.2 Wie? 6.1.3 Wo? 6.1.3 Wann? 6.1.4 Warum? 6.1.5 Zusammenfassung zu den rituellen Handlungen an Bittplätzen 6.2 Gegenseitiger Einfluss der griechisch-römischen und der ägyptischen Kultur im Rahmen der individuellen Religionsausübung 6.2.1 Kontakte und Transfer von Ideen innerhalb Ägyptens 6.2.2 Kontakte zu den Kulturen des Mittelmeerraumes 7 Zusammenfassung der Untersuchung zu den Bittplätzen an ägyptischen Tempeln 8 Katalog Fayum Kat. 1: Bacchias Kat. 2: Karanis /Kom Auschim – Zwei Tempel des Soknopaios und Pnepheros / Petesucho Kat. 3: Narmouthis / Medinet Madi – Tempel der Renenutet Kat. 4: Qasr Qarun / Dionysias – Tempel des Sobek Kat. 5: Soknopaiou Nesos – Tempel des Soknopaios Kat. 6: Tebtynis / Kom Umm el-Boreigat – Heiligtum eines Krokodilsgott Siwa Kat. 7: Aghurmi – Tempel des Amun (Zeus) Kat. 8: Bilad el-Rumi Kat. 9: Zeitun Baharija Kat. 10: Ain el-Tibniya – Alexander-Tempel des Amun Kat. 11: Qasr el-Bawiti – Tempel des Amun-Re von der Oase, Amun-Chons (Herakles/ Herkules-Tempel) & Tempel des Bes Dachla Kat. 12: Ain Amur – Tempel des Amun-Nacht Kat. 13: Ain Birbiya – Tempel des Amun-Nacht Kat. 14: Amheida – Tempel des Thot Kat. 15: Deir el-Hagar – Tempel der Thebanischen Triade bzw. Amun-Re Kat. 16: Kellis (Ismant el-Charab) – zwei Tempel: für Tutu und Neith sowie für Tapsais Charga Kat. 17: Ain Dabaschiya – Tempel des Anubis (?) Kat. 18: Hibis – Tempel des Amun und Mut Kat. 19: Ain el-Labacha Kat. 20: Manawir – Tempel des Osiris -jw Kat. 21: Nadura – 2 Tempel der Gottheiten der Thebanischen Triade (Mut, Amun, Chons) Kat. 22: Qasr el-Dusch – 2 Tempel der Isis und des Osiris Kat. 23: Qasr el-Ghueita – Tempel des Amun und der thebanischen Triade Kat. 24: Qasr el-Zayan – Tempel des Amun(-Re) von Hibis und der thebanischen Triade Niltal Unterägypten Kat. 25: Heliopolis – Tempel des Reharachte-Atum Kat. 26: Memphis – Tempel des Ptah Oberägypten Kat. 27: Deir el-Medine – Tempel der Hathor Kat. 28: Deir el-Schelwit – Tempel der Isis Kat. 29: Dendera – Tempel der Hathor und Tempel der Isis Kat. 30: Edfu – Tempel des Horus Kat. 31: Karnak Kat. 32: Kom Ombo – Doppeltempel des Sobek und Haroeris Kat. 33: Luxor – Tempel des Amun Kat. 34: Medinet Habu – Tempel von Ramses III. Kat. 35: Schenhur – Tempel der Isis Nubien Kat. 36: Dakke – Tempel des Thot Kat. 37: Kalabscha – Tempel des Mandulis Griechenland – gräco-ägyptische Heiligtümer Kat. 38: Delos – Sarapeion A - Inseln Griechenland) – Tempel für Sarapis, Isis, Anubis Delos – Sarapeion C – Tempel für Sarapis, Isis, Anubis, Harpokrates, Hydreios Kat. 39: Eretria – Festland (Griechenland) – Tempel für Isis, Sarapis und Anubis Kat. 40: Thessaloniki Kleinasien – gräco-ägyptische Heiligtümer Kat. 41: Pergamon – Rote Halle Italischer Raum – gräco-ägyptische Heiligtümer Kat. 42: Pompeji – Isis-Tempel Afrika – gräco-ägyptische Heiligtümer Kat. 43: Sabratha – 2 Tempel für Isis, Sarapis und Harpokrates 9 Bibliographie |
