Die „Zwei Körper des Königs“ in den westsemitischen Kulturen
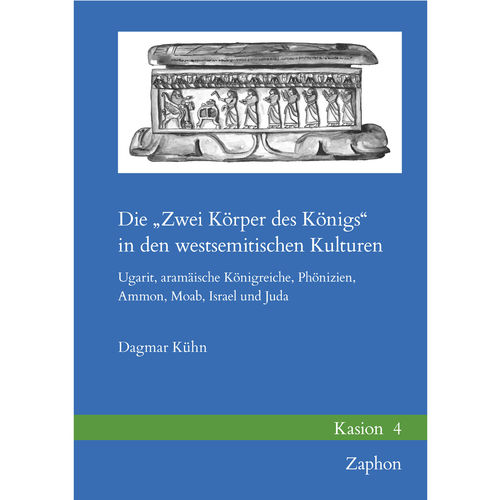
Die „Zwei Körper des Königs“ in den westsemitischen Kulturen.
Ugarit, aramäische Königreiche, Phönizien, Ammon, Moab, Israel und Juda
Dagmar Kühn
Kasion 4
2018
ISBN 978-3-96327-052-9
XIV + 437 Seiten / 17 x 24 cm / Hardcover, Fadenheftung
Buch + E-Book (ISBN 978-3-96327-053-6): 130,00 €, auf Anfrage
| Inhalt |
Dagmar Kühn untersucht das altorientalische und alttestamentliche Königtum vor dem Hintergrund des Konzepts der „Zwei Körper des Königs“, das der Historiker Ernst H. Kantorowicz für das europäische Mittelalter erarbeitet hat, nach welchem der König einen sterblichen Körper und einen unsterblichen Körper besaß, die ungetrennt in seiner Person zusammenkamen. Die Juristen der elisabethanischen Tudor-Zeit entwickelten ihre Lehre über die „The king’s two bodies“, um zu begründen, dass die natürliche Person des Königs (body natural) durch den unsterblichen Körper (body politic) von aller Unvollkommenheit und Schwäche befreit wurde. Jede der erörterten westsemitischen Kulturen entwickelte eigene, bisweilen aber einander ähnliche Strategien zur Ausstattung des body politic mit Insignien und zur bildhaften Repräsentation des body politic sowie zu seiner Aufrechterhaltung in Krisenzeiten, insbesondere in der Bedrohung des body natural durch Krankheit, Gefahr und Tod. In Ugarit lassen sich Aspekte der Königsideologie besonders in den Königsepen Kirta und Aqhatu finden, in deren Helden Kirta, Danʾilu und Aqhatu sich das Schicksal des ugaritischen Königs widerspiegelt. Eine Parallelisierung der Götter und der ugaritischen Könige zeigt sich im Schicksal Baʿals, der im Baʿals-Zyklus ein Königtum begehrt, es erhält und durch widrige Umstände wieder verliert. Auffällig ist die enge Bindung der Könige von Ugarit an die Götter des Königtums. Die Kontinuität der Dynastie war vom Segen der Götter abhängig, ebenso das Wohl des body natural. Das anschaulichste Beispiel der „Zwei Körper des Königs“ bei den Phöniziern stellt der Aḥirom-Sarkophag aus Byblos dar. Während im Sarkophag die Leiche des Königs bestattet lag (body natural), symbolisierte die thronende effigies im Relief auf der Wanne, vor der ein Opfertisch mit Gaben abgebildet ist, den unsterblichen body politic, der Beopferung erwarten darf. In den Texten des Alten Testaments wird deutlich, dass den Verfassern die Aspekte der altorientalischen Königsideologie bekannt waren und sie auch um die ewige (body politic) und menschliche (body natural) Komponente des Königtums in der Person des Königs wussten, die sie entsprechend in ihren theologischen Beurteilungen verwendeten. Vor allem die Psalmen und andere weisheitliche Texte haben das ideale Bild des Königs (body politic) bewahrt, der nach seiner Inthronisation als Sohn Gottes galt und in seinem Amt als Gott bezeichnet werden konnte. |
|---|---|
| Inhaltsverzeichnis |
Erster Teil: Ernst H. Kantorowicz: „The King’s Two Bodies“ – „Die Zwei Körper des Königs“ I. Zu Person und Werk von Ernst H. Kantorowicz II. Die „Zwei Körper des Königs“ nach Ernst H. Kantorowicz 1. Das christozentrische bzw. theokratische Königtum: der König als gemina persona 2. Das rechtsbezogene Königtum: der König als Instrument der Gerechtigkeit 3. Königtum und Staat: ein corpus politicum 4. Strategien zur Konstruktion eines unsterblichen body politic 5. humanitas III. Die Rezeption und Weiterentwicklung des Konzepts der „Zwei Körper des Königs“ im Anschluss an E. H. Kantorowicz Zweiter Teil: Die Rezeption der „Zwei Körper des Königs“ in der Erforschung der Kulturen des Alten Orients – ein Überblick I. Die Rezeption der „Zwei Körper des Königs“ in der Ägyptologie 1. Der königliche Ka – der body politic des ägyptischen Königtums (Lanny Bell) 2. Repräsentation des königlichen Ka in den Ka-Statuen 3. Die Erneuerung des königlichen Ka im Rahmen des Opetfestes am Luxor-Tempel 4. Der königliche Ka nach dem Tod des Pharao 5. Die pharaonische Königsgrablege des Neuen Reiches im interdisziplinären Vergleich (Rolf Gundlach) 6. Der „mystische Körper“ des Pharao (Mario Liverani) II. Die Rezeption der „Zwei Körper des Königs“ in der Hethitologie 1. Hethitische Königsideologie: der hethitische Staat – ein corpus politicum (Frank Starke) 2. Zur Kritik des Ansatzes von Frank Starke 3. Korrektur: Der hethitische König als Verkörperung des Wohlergehens des hethitischen Staates 4. Der Tod des Königs: Die Herstellung einer effigies zur Aufrechterhaltung des Königtums (Theo van den Hout) III. Die „Zwei Körper des Königs“ in Mesopotamien 1. Einführung 2. Der König als Sondergeschöpf 3. Der König als Abbild der Götter 4. Die Investitur des Königs 5. Der König im babylonischen akītu-Fest: die Erneuerung des body politic 6. Substitutionsrituale: Schutz des body politic 7. Der body politic des Königs im ikonographischen Programm der mesopotamischen Herrscher (Irene Winter) 8. Der König als Verkörperung des Rechts IV. Qaṭna (Syrien): Ahnen als body politic des Königtums (Herbert Niehr) V. Konsequenzen des forschungsgeschichtlichen Überblicks für das weitere Vorgehen Dritter Teil: Die „Zwei Körper des Königs“ in den westsemitischen Kulturen I. Ugarit 1. Einführung 2. Die „Zwei Körper des ugaritischen Königs“ und die Tragik der Sterblichkeit des Königs 3. Der König und die Götter 4. Der König und das ugaritische Königtum: die Konstruktion der „Zwei Körper des Königs“ 5. Der König und das Recht 6. Die Bedeutung der dynastischen Ahnen für den body politic 7. Zusammenfassung II. Aramäer 1. Einführung 2. Samʾal (Yādiya) 3. Bit Baḫiani 4. Hamath und Luaš 5. Aram-Damaskus 6. Die Königssprüche des aramäischen Aḥiqar 7. Zusammenfassung III. Phönizier 1. Einführung 2. Byblos 3. Sidon 4. Tyros 5. Zusammenfassung IV. Ammon und Moab 1. Ammon 2. Moab 3. Zusammenfassung V. Israel und Juda 1. Zur Quellenlage 2. Ikonographische und epigraphische Zeugnisse des body politic in der Spätbronzezeit und Eisenzeit Israels und Judas 3. Die „Zwei Körper des Königs“ in den Texten des Alten Testaments 4. Die Verleihung des Königtums und die Ausstattung des doppelten Körpers 5. Erneuerung des body politic 6. Der König und der Kult 7. Kontinuität des body natural: Dynastisches Königtum 8. Der Tod des Königs 9. Der doppelte Körper des alttestamentlichen Priesters 10. Der doppelte Körper des königlichen Menschen 11. Zusammenfassung Schluss Abkürzungen Literaturverzeichnis Abbildungsverzeichnis Indices Abbildungen
|
